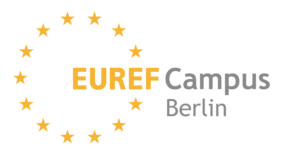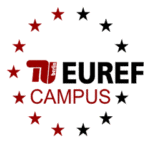Kalenderblatt Sonntag, 12. November 2023
Zitat des Tages: „Die Zivilisation ist nichts anderes als ein Farbanstrich, der vom nächsten Regen fort gewaschen wird.“ Auguste Rodin (1840-1917)
12.11.1936: Golden Gate Bridge: Ein Wahrzeichen für San Francisco In Kaliforniens Metropole San Francisco überspannt ab heute ein einzigartiges Bauwerk die berühmte Meerenge im Pazifik: die Golden Gate Bridge, längste Hängebrücke der Welt. Lange zweifelten Experten wegen der diffizilen geografischen Bedingungen an der Realisierung dieses gewagten Projekts. Am 12. November 1936 aber wird die grandiose Stahl-Beton-Konstruktion unter Leitung des Ingenieurs Joseph P. Strauss fertiggestellt.
In Kaliforniens Metropole San Francisco überspannt ab heute ein einzigartiges Bauwerk die berühmte Meerenge im Pazifik: die Golden Gate Bridge, längste Hängebrücke der Welt. Lange zweifelten Experten wegen der diffizilen geografischen Bedingungen an der Realisierung dieses gewagten Projekts. Am 12. November 1936 aber wird die grandiose Stahl-Beton-Konstruktion unter Leitung des Ingenieurs Joseph P. Strauss fertiggestellt.
Mehr Details:
Wenn man bedenkt, welchen Widrigkeiten sich Baumeister Joseph P. Strauss bei der Planung der gewagten Konstruktion und Beschaffung der finanziellen Mittel ausgesetzt sah, dann nimmt sich die effektive Bauzeit von vier Jahren recht bescheiden aus. 20 Jahre kämpfte er darum, die Brückenkonstruktion über das „Golden Gate“ realisieren zu können und musste ständig neue Einwände widerlegen. Kaliforniens Behörden argumentierten, dass die Strömung an dieser Stelle zu tückisch, der Pazifik zu tief, die Brücke zu hoch und die Distanz zwischen den Brückenpfeilern zu weit sei. Hinzu kam die bekanntlich große Erdbebengefahr in diesem Gebiet sowie die unberechenbaren Meereswinde. Und schließlich zog die Obrigkeit auch eine eventuelle Kriegsgefahr ins Kalkül, bei der die Brücke womöglich zerstört und in der Folge der Zugang zum Hafen blockiert sein könnte.
Strauss gelang es, alle Instanzen von seinem Projekt zu überzeugen. Tatsächlich gestalteten sich die Bauarbeiten zu der beeindruckenden Hängebrücke, bei der insgesamt 1 Million Tonnen Stahl verarbeitet wurden, als kompliziert und mit vielen Gefahren verbunden. Die starke Gezeitenströmung beeinträchtigte den Baufortgang, es kam zu etlichen Unfällen, elf davon mit tödlichem Ausgang. Doch am Ende behielt Strauss recht, und das 2,8 km lange und 35 Mio. Dollar teure Bauwerk konnte schließlich im Mai 1937 dem Verkehr übergeben werden. Am 27. Mai spazierten die ersten Fußgänger über die Brücke; einen Tag später, nach der offiziellen Einweihung durch US-Präsident Franklin D. Roosevelt, rollten auch die ersten Autos über die sechsspurige Fahrbahn des Highway 101 – der Schnellstraße, die 67 m über dem Meeresspiegel verläuft und San Francisco mit Marin County im nördlichen Kalifornien verbindet.
Die Brückenkonstruktion wird von zwei riesigen, 227 m aus dem Wasser ragenden Stützpfeilern abgehängt und von 90 cm dicken Kabelsträngen und Tragseilen gehalten. Eine besondere Legierung des Nickel-Chrom-Spezialstahls macht es möglich, dass die Stränge die vorgeschriebene Mindestzugfestigkeit von 155 kg pro mm² erreichen. Mit einer Hauptöffnung zwischen den beiden Pfeilern von 1.280 m verfügt die Golden Gate Bridge über die derzeit größte freie Spannweite. Damit die berühmte orange-rote Brücke, die sich im Licht der Abendsonne von ihrer schönsten Seite zeigt, gegen Rost und andere Witterungseinflüsse gefeit ist, ist ein Handwerkertrupp das ganze Jahr über mit Ausbesserungs- und Malerarbeiten beschäftigt.
Gedenktage:
1999: Der Westen der Türkei wird erneut von einem schweren Erdbeben erschüttert, das die Stärke 7,2 auf der Richter-Skala erreicht und 700 Menschen das Leben kostet. Das Beben im Gebiet um die Stadt Düzce, nur 150 km östlich von Istanbul, gilt als Nachfolgebeben der verheerenden Erdstöße vom 17. August bei Izmit, die über 17.000 Todesopfer gefordert hatten.
1992: Vor dem Berliner Landgericht beginnt der Prozess gegen den ehemaligen Staats- und Parteichef der DDR, Erich Honecker, und fünf weitere führende SED-Politiker (Erich Mielke, Heinz Keßler, Fritz Streletz, Willi Stoph und Hans Albrecht); die Anklageschrift lautet auf vollendeten und versuchten Totschlag an Flüchtlingen an der innerdeutschen Grenze.
1944: In einem norwegischen Fjord wird das deutsche Kriegsschiff „Tirpitz“ in Norwegen von britischen Kampffliegern bombardiert und versenkt. Nahezu die Hälfte der 2.500 Mann starken Besatzung des letzten kampfbereiten deutschen Schlachtschiffs kommt dabei ums Leben.
1918: In Wien verkündet Franz Dinghofer, Präsident des Österreichischen Staatsrates, nach dem Regierungsverzicht Kaiser Karls vom Vortag die Gründung von Deutsch-Österreich als Bestandteil der Deutschen Republik. Der Anschluss an Deutschland wird im darauffolgenden Jahr durch den Friedensvertrag von St. Germain jedoch verboten.
1877: In Friedrichsberg bei Berlin öffnet heute das erste deutsche Telegrafenamt mit Fernsprechern seine Pforten. Dort stehen den Bürgern für die private Nutzung probeweise Telefone der Firma Siemens & Halske zur Verfügung. Wer einen solchen „neumodischen“ Apparat benutzen will, muss fünf Mark berappen.
Geburtstage:
1945: Neil Young; kanadischer Gitarrist und Sänger. Als vierter Mann kam er im August 1969 beim Festival Woodstock zur Band Crosby, Stills, Nash & Young; zuvor war er Mitglied bei diversen Bands, u.a. Buffalo Springfield. Der schönste Song in seiner Solistenlaufbahn gelang ihm 1972 mit dem millionenfach verkauften Titel „Heart of Gold“ aus dem Album „Harvest.
1929: Michael Ende († 28.8.1995); deutscher Schriftsteller. Als Autor von phantasievollen Kinder- und Jugendbüchern sowie Theaterstücken (z.B. „Der Goggolori“) erfreute er Jung und Alt. Besonders beliebt bei den kleinen Lesern ist „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Seine beiden internationalen Bestseller „Die unendliche Geschichte“ und „Momo“ wurden darüber hinaus erfolgreich verfilmt (1983/1986).
1929: Grace Kelly, spätere Fürstin Gracia Patricia († 14.9.1982); US-Schauspielerin und nach der Heirat mit Fürst Rainier III. (1956) Landesmutter von Monaco. Als sie ihren späteren Ehemann bei Dreharbeiten in Südfrankreich kennen lernte, war die makellos schöne Blondine bereits ein oscargekrönter Weltstar. Hauptrollen spielte sie im Western „High Noon“ und in mehreren Thrillern von Alfred Hitchcocks (u.a. „Bei Anruf Mord“).
1923: Vicco von Bülow († 22.8.2011), besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Loriot“ (frz.: Pirol); deutscher Karikaturist, Autor, Humorist und Schauspieler. Großer Erfolg war ihm sowohl mit seinen Karikaturen im „stern“ und seinem Cartoon-Hund „Wum“ als auch mit seinen Kinofilmen („Papa Ante Portas“, „Ödipussi“) und TV-Sketchen beschieden, in denen er auf höchst amüsante Weise menschliches Verhalten auf die Schippe nimmt.
1840: Auguste Rodin († 17.11.1917); französischer Bildhauer, Maler und Grafiker. Seine vielfältigen Skulpturen, darunter berühmte Werke wie „Der Denker“, die Marmorstatue „Der Kuss“ und die „Bürger von Calais“, sind größtenteils im Pariser Musée Rodin ausgestellt und erfreuen sich dort eines großen Besucherandrangs. Der deutsche Schriftsteller Rilke arbeitete in den Jahren 1905-06 in Paris als Sekretär Rodins.
Copyright: Rosemarie Elsner